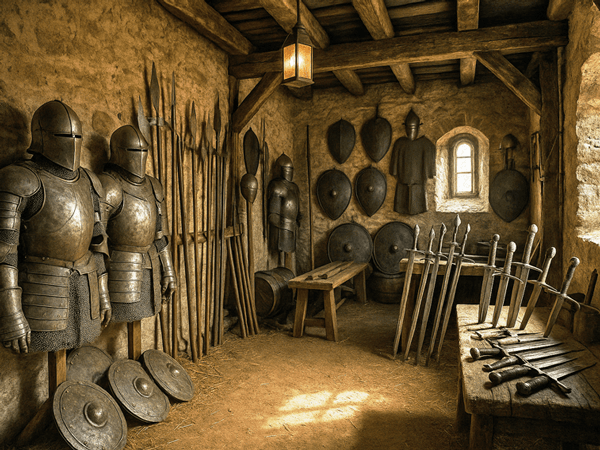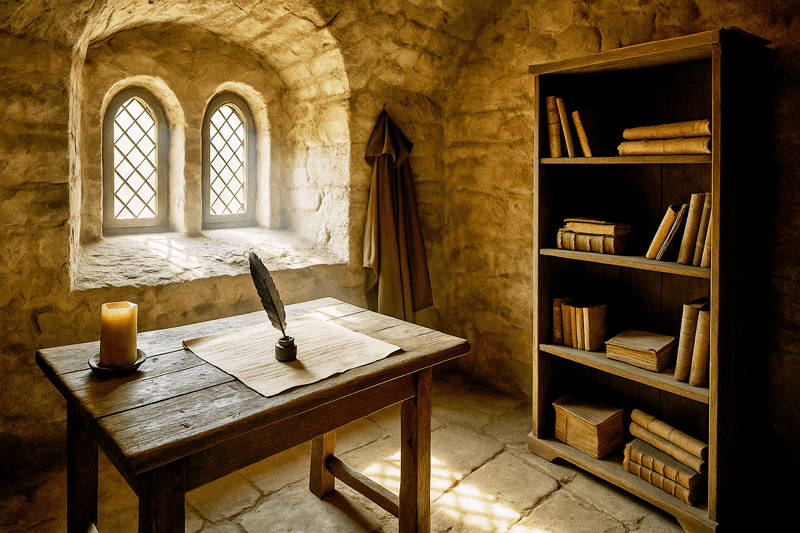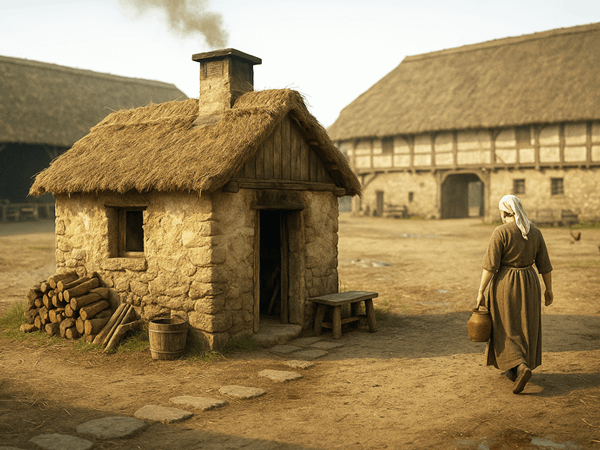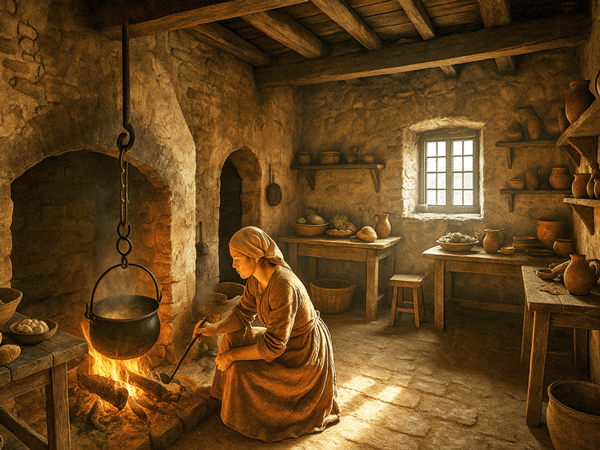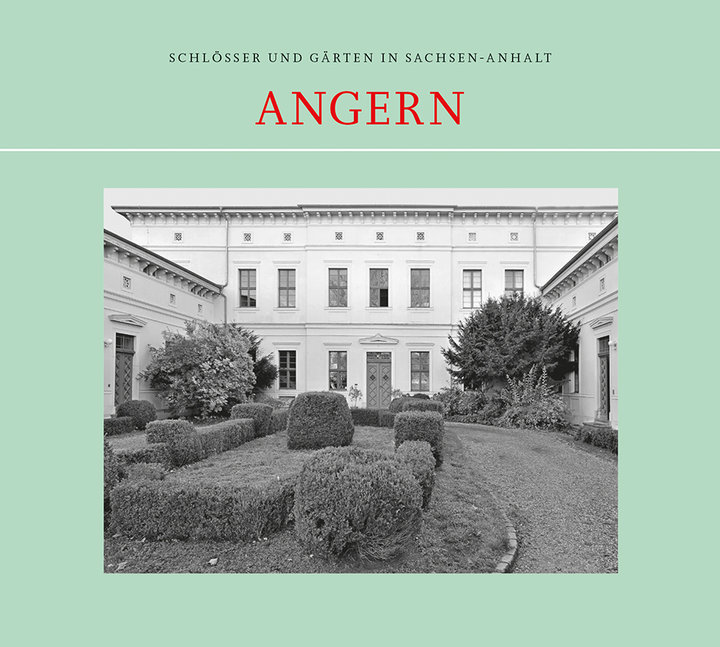Befunde der Burg
Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in Sachsen-Anhalt stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar.
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Die südliche Begrenzung der Hauptburginsel von Angern stellt einen der bedeutendsten Abschnitte der gesamten Burganlage dar. Ihre unmittelbare Lage am Wassergraben, die Verbindung zur Turminsel sowie die massive Bruchsteinstruktur machen sie zu einem Schlüsselbereich für die bauhistorische Analyse. Insbesondere die südwestliche Partie mit der erhaltenen Ringmauer sowie die südliche Außenwand des Palas bieten Einblicke in die hochmittelalterliche Wehr- und Wohnarchitektur Norddeutschlands.
Befund E3: Westliche Ringmauer
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Die vertikale Erschließung mittelalterlicher Palasbauten erfolgte in der Regel über fest eingebaute Innentreppen, die sowohl funktionale als auch symbolische Bedeutung trugen. In der Burg Angern hat sich eine solche Treppenanlage im Palas erhalten, die vom tonnengewölbten Erdgeschoss in das Obergeschoss führte. Die Treppe befindet sich rechts vom Haupteingang des Palas und ist in das originale Mauerwerk integriert. Ihre Lage, Konstruktion und Materialität sprechen für eine bauzeitliche Entstehung um 1340 und machen sie zu einem bedeutenden Zeugnis hochmittelalterlicher Wohnarchitektur in der norddeutschen Tiefebene.
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Freigelegter Zugang zum ursprünglichen Palaseingang auf Burg Angern – Archäologisch-bauhistorischer Befundbericht: Eingangsbereich: Im Mauerverband des südlichen Gewölberaums sind Reste eines überbauten, heute verschütteten Zugangs vom Innenhof aus nachweisbar. Der Befund deutet auf ein ursprüngliches Portal in der westlichen Palasmauer hin, das später geschlossen wurde. Der Zugang wurde wahrscheinlich bereits in der Barockzeit – spätestens jedoch im Zuge der Auffüllung des Hofniveaus – dauerhaft unpassierbar gemacht. Dennoch markiert dieser Eingang die zentrale Erschließung des Palas im Mittelalter.
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Der Sockelbereich der Hauptburg von Angern stellt eines der ältesten und am besten erhaltenen Bauelemente der hochmittelalterlichen Wasserburganlage dar. Als unmittelbare Gründungsschicht der aufgehenden Ringmauer dokumentiert er die statische, funktionale und bautechnische Basis der Gesamtstruktur. Seine exponierte Lage oberhalb des ehemaligen Wassergrabens, die charakteristische Bauweise mit unbehauenen Feldsteinen sowie das Fehlen späterer Überformungen machen ihn zu einem zentralen Referenzpunkt für die bauhistorische Analyse der Burg.
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Die vermauerten Fensteröffnungen in der westlichen und östlichen Ringmauer der Hauptburg Angern belegen bauliche Anpassungen zwischen 1650 und 1735. Ihre Position, Ausführung und spätere Verschließung spiegeln Veränderungen im Geländeniveau sowie die funktionale Umgestaltung der Burganlage nach der Zerstörung von 1631 wider. Die Befunde dokumentieren damit den Übergang von mittelalterlicher Wirtschaftsstruktur zu barocker Nutzung.
- Details
- Kategorie: Befunde der Burg
Das tonnengewölbte Erdgeschoss des südlich an den Wehrturm anschließenden Nebengebäudes auf der Turminsel der Burg Angern stellt ein herausragendes Beispiel für die funktionale Kopplung von Wirtschafts-, Lager- und Versorgungsräumen im Kontext hochmittelalterlicher Wasserburgen dar. Die Anlage besteht aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Tonnengewölben, die als baulich und funktional geschlossene Einheit konzipiert sind. Während der nördliche Gewölberaum mit dem Erdgeschoss des Wehrturms unmittelbar verbunden ist und wesentliche Merkmale der mittelalterlichen Bauphase bewahrt, wurde der südliche Raum im Zuge der barocken Umbauten im Jahr 1738 vollständig neu aufgemauert – infolge eines dokumentierten Höhenfehlers beim Bau des angrenzenden neuen Schlossflügels. Die dabei entstandene Absenkung des Gewölbeniveaus ist durch eine bauliche Stufe von ca. 38 cm bis heute nachvollziehbar.