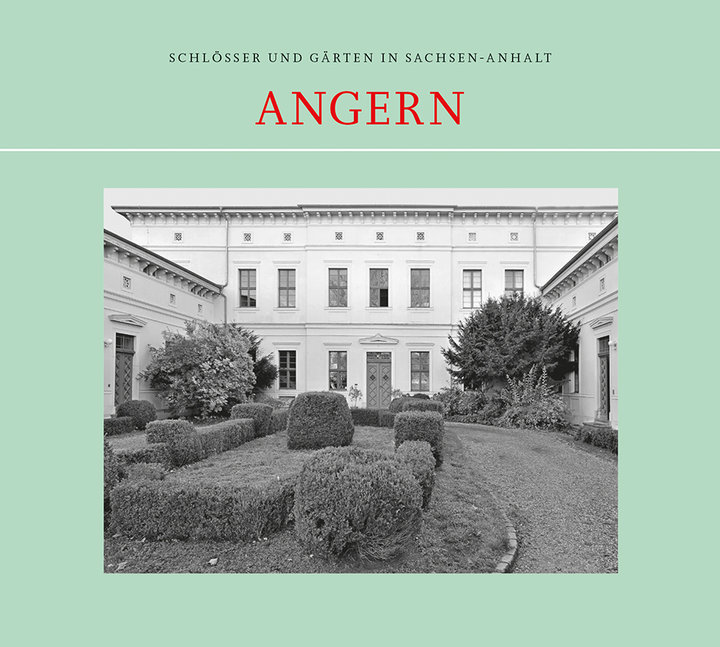Entwicklung und Erhaltung der Hauptburg Angern (1648–1738) – Chronologisch kommentiert und ergänzt um die archäologischen Befunde. Die Burg Angern erlebte eine wechselvolle Geschichte, geprägt von kriegerischer Zerstörung, wirtschaftlichem Niedergang und pragmatischen Wiederaufbauversuchen. Nach schweren Schäden im Dreißigjährigen Krieg wurde die Hauptburg im 17. Jahrhundert nur notdürftig wieder instand gesetzt. Auf den alten Fundamenten entstand ein schlichtes neues Wohnhaus, das den ruinösen Turm integrierte. Im frühen 18. Jahrhundert, im Zuge des barocken Neubaus eines Herrenhauses, standen die verbliebenen Baureste der mittelalterlichen Hauptburg erneut im Fokus. Die nachfolgende Darstellung zeigt chronologisch die wichtigsten Befunde, Entscheidungen und den Umgang mit der historischen Substanz, ergänzt durch aktuelle bauarchäologische Erkenntnisse.
1631: Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg
Im Sommer 1631 wurde die Burg Angern während der Kampfhandlungen im Raum Magdeburg schwer beschädigt. Kaiserliche Truppen hatten die Anlage zunächst als Vorposten genutzt, bevor sie in einem nächtlichen Angriff durch das Holksche Regiment – eine schwedische Reitereinheit unter Heinrich von Holk – überfallen und niedergebrannt wurde.
„Bei dem anschließenden Brand des Dorfes kam auch das Schloss zu Schaden. Nach einem alten Bericht blieben nur die beschädigte Brauerei, ein Viehstall ohne Dach und das ebenfalls beschädigte Pforthäuschen stehen.“ (Quelle: Dorfchronik Angern )
➔ Kommentar: Turm, Hauptburg und Ringmauer wurden offenbar nicht durch Artilleriebeschuss zerstört, sondern vermutlich infolge des Feuers, einstürzender Aufbauten und späterer Materialentnahme aufgegeben. Nur Nebengebäude und das Pforthaus überstanden den Brand.
1648: Westfälischer Frieden
Der Westfälische Frieden im Jahr 1648 beendete die Kämpfe offiziell, aber: Der Wiederaufbau setzte nicht sofort ein. Viele Regionen – auch Angern – litten noch jahrzehntelang unter wirtschaftlicher Not, zerstörter Infrastruktur und Bevölkerungsverlust. In Angern wohnte der Gutsherr Henning von der Schulenburg wohnte weiterhin unter schwierigsten Bedingungen auf den Resten der Burg - entweder im erhaltenen Brauhaus, im Pforthäuschen oder wahrscheinlicher in den noch erhaltenen Gewölben des Palas auf der Hauptburg.
1650: Kirchenvisitation
Eine Kirchenvisitation im Haus Heinrich von der Schulenburg wurde durchgeführt.
➔ Kommentar: Ein Hinweis darauf, dass sich langsam wieder eine kirchliche und administrative Struktur etablierte und ein bewohnbarer Gebäudeteil vorhanden war bzw. das noch erhaltene Brauhaus genutzt wurde.
1650–1672: Nutzung der vorhandenen Substanz
Die Keller (gemeint sind die Gewölbe im Erdgeschoss des Palas) und der Turm blieben erhalten:
„Dafür werden aber die vier Keller und der alte Turm erwähnt.“ (Quelle: Dorfchronik Angern)
➔ Archäologischer Befund: Nördliche und westliche Außenwand des Palas (zum Innenhof) mit Umkehrgang und Treppe ins Obergeschoss des Palas erhalten. Das Eingangsgewände des Palas mit Werksteinen, Sockel und einige Wände der Hauptburg blieben bis heute erhalten. Erdgeschoss des Wehrturms mit Schießscharte und Ausgang zum Tonnengewölben bis heute erhalten.【Befunde Palas】【Befunde Turminsel】
1672: Zustand des Turms und Konkurs
1672 wurde der Konkurs erklärt, der gesamte Besitz taxiert und danach zur Versteigerung ausgeschrieben. Ein größeres Wohnhaus scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. Außerdem war noch der alte Turm vorhanden, von dem es heißt:
„Worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe, absonderlich im Fundament, sehr baufällig und viel zur Reparatur kosten möchte, auch dem Besitzer fast mehr schädlich als zuträglich, so ist er hierbei in keinen Anschlag gebracht.“ (Quelle: Dorfchronik Angern )
➔ Kommentar: Der alte Turm war 1672 so stark verfallen, dass er wirtschaftlich als wertlos galt. Der Wiederaufbau der Burg erfolgte zunächst nur sehr notdürftig.
➔ Archäologischer Befund: Das erste Geschoss des Bergfrieds auf der Südinsel blieb vollständig erhalten【Befunde Turminsel】.
1680: Rückerwerb und einfacher Wiederaufbau
Da sich kein Käufer fand, konnte Heinrich von der Schulenburg seinen Besitz zurückerwerben und ein neues Wohnhaus errichten.
„Der Neubau bestand aus dem zweistöckigen Haupthaus mit einer zweiflügeligen Eingangstür und 15 Fenstern, einem kleineren einstöckigen Nebengebäude und dem dazwischen stehenden Rest des alten Turmes.“ (Quelle: Dorfchronik Angern)
➔ Kommentar: Vermutlich auf der südlichen Turminsel wurde ein neues Wohnhaus errichtet.
1737: Schäden am Turmgewölbe
„Sonsten ließ ich auch die in dem Turmgewölbe gehabten Sachen hervorbringen, welche in ungemein schlechten Stande angetroffen, die Hälfte vom Leinzeuge ist verdorben.“ (Quelle: Rep. H Angern Nr. 412)
➔ Kommentar: Das Gewölbe des Wehrturms zeigte starke Feuchteschäden. Das eingelagerte Leinen, das Christoph Daniel wohl für den Bau des Schlosses dort eingelagert hatte waren größtenteils zerstört.
1737: Einsturzgefahr und Maßnahmen
„Dieser Fehler verursacht, dass der Hof vor dem Haus verniedrigt werden muss, wodurch das Turmgewölbe nebst dem dabei stehenden Keller eingebrochen und verschüttet werden muß.“ (Quelle: Rep. H Angern Nr. 412)
➔ Kommentar: Um einen neuen Hof anzulegen, sollten die Keller - gemeint ist das Palas-Erdgeschoss - sowie das Turmgewölbe abgerissen und bewusst verschüttet werden.
18. November 1737: Diskussion um Erhaltung
„Nachdem ich aber Ew. Exz. Sentiment eröffnet, so haben endlich H. Landbaumeister […] gefunden, daß der kleine Graben sowie die Gewölbe können konserviert werden, auf die Maße, daß man die Decke derer Gewölbe ganz wieder neu schlüge und solche niedriger mache.“ (Quelle: Nr. 4, 18.11.1737)
➔ Kommentar: Im November 1737 wurde von Christoph Daniel von der Schulenburg beschlossen, die mittelalterlichen Gewölbe im Erdgeschoss des Palas nicht aufzugeben, sondern sie in veränderter Form zu erhalten. Dazu sollten die Decken abgetragen, neu aufgemauert und niedriger angelegt werden, um sie an die neue Hofgestaltung anzupassen. Dieser bauliche Eingriff entspricht genau dem heutigen Befund: Die bis dahin vollständig erhaltenen Tonnengewölbe aus Bruchstein wurden nach 1737 abgerissen und durch neue Tonnengewölbe aus Backsteinziegeln ersetzt. Aufgrund der erhaltenen Bruchsteinreste am Unterbau der Tonnen und der noch vorhandenen westlichen Außenwand des Palas mit dem Umkehrgang ist eindeutig nachvollziehbar, dass die neuen Ziegelgewölbe auf den ursprünglichen Fundamenten errichtet wurden. Dabei wurden die Raumgrößen und Grundstrukturen beibehalten, sodass der Grundriss des mittelalterlichen Palas bis heute vollständig erhalten geblieben ist.
➔ Archäologischer Befund: Über dem Flur und dem nördlichen Palas-Raum sind die neuzeitlichen Ziegelgewölbe erhalten und dokumentiert. Im südlichen Palas-Raum wird aufgrund der Lage und der bauarchäologischen Gegebenheiten ein entsprechendes, bislang verschüttetes Ziegelgewölbe vermutet. Die heute sichtbaren Ziegelgewölbe des Palas gehen direkt auf die Bauentscheidung von 1737 zurück. Sie ruhen auf den Fundamenten der hochmittelalterlichen Burg und bewahren trotz der Erneuerung die originale Raumstruktur des Palas.
22. Januar 1738: Skepsis gegenüber alten Kellern
„Böse sei aber der Meinung, es wäre unpracticabel, die alten Keller behalten zu wollen.“ (Quelle: Nr. 7, 22.1.1738)
➔ Kommentar: Trotz Zweifel des Bauingenieurs Böse an der Wiederverwendung der alten Strukturen wurden die Gewölbe wie von Christoph Daniel gewünscht neu errichtet.
Literaturverzeichnis
- Brigitte Kofal: Dorfchronik Angern
- Gutsarchiv Angern, Rep. H Angern Nr. 412, Nr. 4 (18.11.1737), Nr. 7 (22.01.1738).
- Schulenburg, Christoph Daniel von der: Mémoire zur Anlage des Schlossparks Angern, 1745.
- Denkmalliste des Landes Sachsen-Anhalt, Eintrag Schloss Angern, Stand: 2023.
- Meyhöfer, Andreas (Hrsg.): Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Halle: Landesamt für Denkmalpflege, 2008.
- Wulf, Andrea: Die Eroberung der Natur. Eine Geschichte der Gartenkunst, München: Bertelsmann, 2009.
- Krause, Werner: Die Burgen der Altmark: Formen, Funktionen und historische Entwicklung, Magdeburg: Mitteldeutscher Verlag, 1995.
- Störmer, Wilhelm: Der Adelssitz im Mittelalter – Untersuchungen zur Entwicklung von Wehr- und Wohnfunktion, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973.